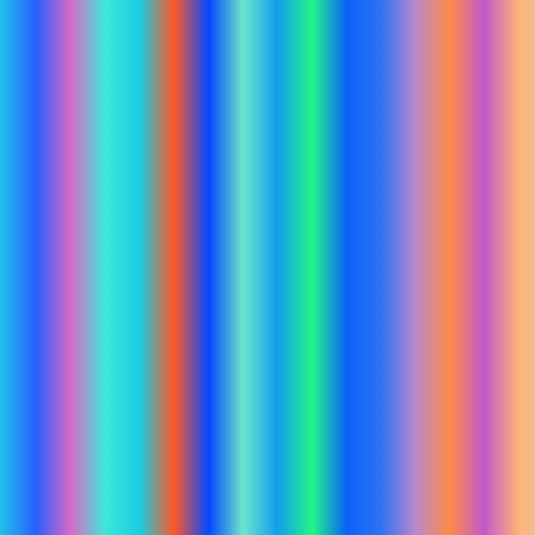„Erinnerungskultur muss mehr als nur die Mehrheitsgesellschaft im Gedächtnis be(in)halten“ Intersektionale Ansätze

- 11. KupoBuko
Die Frage, wie in einer Gesellschaft bestimmter historischer Ereignisse und Entwicklungen gedacht wird und wo Schwerpunkte in der Erinnerungskultur gesetzt werden, ist Teil von Aushandlungsprozessen. Seit einigen Jahren werden vermehrt Stimmen von Gruppierungen laut, die sich in der offiziellen Erinnerungskultur nicht repräsentiert oder gar ausgeschlossen sehen. Tatsächlich kommen viele Perspektiven in Geschichtsbüchern, in Ausstellungen oder an Gedenkorten nicht – oder nur am Rande – vor.
Doch es ist etwas in Bewegung geraten. Dies zeigten zum Beispiel 2019/2020 einige Ausstellungs- und Publikationsprojekte anlässlich der Jubiläen 30 Jahre Mauerfall / 30 Jahre Deutsche Einheit, bei denen die Erfahrungen von verschiedenen Communitys in den Fokus gerückt wurden. Dazu gehörte etwa eine Ausstellung der Bildungsstätte Anne Frank mit dem Titel „Anderen wurde es schwindelig. 1989/90: Schwarz, Jüdisch, Migrantisch – Sonderausstellung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls“ oder die Publikation „Labor 89. Intersektionale Bewegungsgeschichte*n aus West und Ost“. Im Herbst 2021 stellte das Kulturprojekt „Kein Schlussstrich“ zu den Verbrechen des NSU die Perspektiven der Opfer und der migrantischen Communitys in den Vordergrund, und das Oral History-Projekt Archiv der Flucht macht zahlreiche sehr unterschiedliche Migrationsgeschichten digital zugänglich.
Perspektiven erweitern
Diese Pluralisierung von Erinnerungen, von Perspektiven auf Geschichte bietet ein großes Potenzial für die Erinnerungsarbeit insgesamt, davon ist zum Beispiel Peggy Piesche überzeugt. Sie ist eine Schwarze deutsche Literaturwissenschaftlerin, geboren und aufgewachsen in der DDR. Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls stellte sie im Rahmen des Projekts „Labor89“ Porträts von acht Aktivist*innen aus Schwarzen, People of Color (PoC) und/oder queer-feministischen Kontexten und Communitys aus Ost- und Westdeutschland in einem Sammelband zusammen. Die Porträtierten schildern ihre Erlebnisse vor und nach 1989, und welche Veränderungen das Ende der DDR für ihr privates Leben und ihr politisches Engagement, zum Beispiel in der Frauen- und Lesbenbewegung, bedeutete. Ergänzt werden die Porträts durch zeitgeschichtliche Dokumente wie Fotos, Veranstaltungsplakate und -programme etc. Die vorherrschenden Narrative der kollektiven Erinnerung an diese Zeit erfahren so plurale Erweiterungen durch bisher marginalisierte Ereignisse und Diskurse.
»Auch diskriminierungserfahrene Communitys mit ihren sozialen Kämpfen und Positionierungen müssen Teil eines erinnerungspolitischen Aushandlungsprozesses werden.«
Doch es geht nicht nur um eine Pluralisierung der Geschichte(n) und der Erinnerungskultur, sondern auch darum, einen intersektionalen Ansatz zu verfolgen. Dabei spielen Mehrfachzugehörigkeiten (bei „Labor 89“ etwa: Frauen, Lesben, Schwarze, PoC, Sinti) eine wichtige Rolle, denn je nach Kontext rücken bei den Aktivist*innen verschiedene Aspekte ihrer Zugehörigkeiten in den Vordergrund.
Intersektionale Erinnerungsarbeit
Der intersektionale Ansatz für die Erinnerungsarbeit nimmt Mehrfach-Identitäten, -Zugehörigkeiten und -Diskriminierungen in den Blick. Marginalisierte Geschichten und Diskurse werden bewusst ins Zentrum gerückt. Verschiedene Diskriminierungsformen geschehen gleichzeitig und überschneiden sich. Der Begriff Intersektionalität wurde Ende der 1980er-Jahre geprägt und geht auf die Erfahrungen Schwarzer Feministinnen in den USA zurück, die nicht nur wegen ihres Geschlechts diskriminiert wurden, sondern auch wegen ihrer Hautfarbe oder Klassenzugehörigkeit. Zudem gibt es mehrere Ebenen auf denen Intersektionalität beleuchtet wird, zum Beispiel auf individueller, struktureller oder institutioneller Ebene.
Mehrfache Unterdrückungen, Identitäten und Zugehörigkeiten werden in intersektionalen Ansätzen sichtbar und damit erst besprechbar gemacht. Ziel einer intersektionalen Erinnerungsarbeit ist es, Leerstellen in den vorherrschenden historischen Narrativen aufzuzeigen und zu beleuchten, wie Geschichtsschreibung gerade Überlagerungen von Ausbeutungsverhältnissen und Unterdrückungsverhältnissen weiter reproduziert. Der Fokus der mehrheitsgesellschaftlichen Erinnerung soll verschoben werden.
»Es liegt etwas sehr empowerndes darin, sich in einer kollektiven Erfahrung eingebettet zu wissen, die sich jenseits eines normativen Narrativs versteht. […] Intersektionale Erinnerungsarbeit bedeutet Angebote zu machen, um sich selbst zu erkennen und sich eine Sprache geben zu können.«
Schwarze Menschen, People of Color oder Migrant*innen treten in intersektionalen Ansätzen nicht nur als Ergänzung der bestehenden Erzählungen auf oder als Folie der Entwicklungsprozesse der Mehrheitsgesellschaft. Sie sind Akteur*innen und Gestalter*innen ihrer eigenen Geschichte(n). Um diese sichtbar zu machen, werden Räume gebraucht. Kultur- und Bildungsinstitutionen sind am Zug, diese Handlungs- und Möglichkeitsräume zu schaffen, Platz zu machen für bislang zu wenig sichtbare Perspektiven und Erinnerungen. Diese können andere Fragen hervorbringen und vielleicht auch andere Antworten, mit denen die Institutionen der so genannten Mehrheitsgesellschaft sich auseinandersetzen müssen. Eventuell wird dabei die eigene Zentralität erst bewusst und Selbstverständlichkeiten werden hinterfragt. Dies kann auch eine Chance sein, denn plurale und polylogische Ansätze erweitern die sozialen, politischen und kulturellen Möglichkeitsräume und Teilhabechancen für alle Menschen.
Dekolonisierung
Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit pluralen und intersektionalen Ansätzen für die Erinnerungsarbeit ist die Dekolonialität oder Dekolonisierung. Dies betonte Peggy Piesche, die seit 2021 den Fachbereich Politische Bildung und plurale Demokratie der bpb leitet, im Rahmen einer Fachtagung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten im Oktober 2021. Die Konzepte der Dekolonisierung zielen darauf ab, Manifestationen von kolonial geprägten Ungleichheitssystemen in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen wie Bildung, Kunst, Kultur, Literatur, Wissenschaft, Forschung und Medien, aber auch im öffentlichen Raum und in der Politik sichtbar und somit besprechbar zu machen. Bezogen auf die Aufgaben der politischen Bildung, gesellschaftlicher und kultureller Institutionen sagte Piesche: „Es bedeutet auch, dass wir Methoden und Formate entwickeln, die eine Dekolonisierung von Erinnerung und Wissen ermöglichen.“ Es gelte, rassistische Ausschlussstrukturen auf allen Ebenen anzugehen. Das Konzept der Dekolonialität schaffe Zugangsmöglichkeiten und Reflexionsräume, die plurale Wege ermöglichen und gesellschaftliche Erinnerungsgestaltung polylogisch gestalten können.
Weitere Informationen:
Peggy Piesche (Hg.): Labor 89. Intersektionale Bewegungsgeschichte*n aus West und Ost, Berlin 2020
Dokumentation der bpb-Fachtagung: Politische Bildung Intersektional 25.-27. Oktober 2021 in Erfurt
DLF Kultur Beitrag: Nicht-Weißer Blick auf die Wende: Das neue „Wir“ ohne uns