Programm
Tobias J. Knoblich, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. und Beigeordneter für Kultur, Stadtentwicklung und Welterbe der Landeshauptstadt Erfurt
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung

Claudia Roth MdB ist seit Dezember 2021 Staatsministerin für Kultur und Medien. Zuvor war sie von 2013 bis 2021 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Von 1989 bis 1998 war sie Abgeordnete im Europäischen Parlament. Seit 1998 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90/Die Grünen, deren Parteivorsitzende sie von 2001 bis 2002 und von 2004 bis 2013 war.
Von 1998 bis 2001 war sie Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, zwischen 2003 und 2004 Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt.
Ihre beruflichen Anfänge machte Roth in der Kulturbranche, erst als Dramaturgie-Assistentin, dann als Dramaturgin in Dortmund und Unna. Von 1982 bis 1985 war sie Managerin der Band »Ton Steine Scherben« um Rio Reiser.

Dr. Tobias J. Knoblich *1971, studierte Kulturwissenschaft, Kulturpolitik und Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er war Referent im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sowie Geschäftsführer des Landesverbandes Soziokultur Sachsen. Von 01/2011 bis 01/2019 wirkte er als Kulturdirektor der Landeshauptstadt Erfurt. Seit Februar 2019 ist er Beigeordneter für Kultur, Stadtentwicklung und Welterbe der Landeshauptstadt Erfurt. Berufsbegleitend promovierte er am UNESCO Chair in Cultural Policy for the Arts in Development der Universität Hildesheim. Er ist Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V. und war viele Jahre Kultursenator des Freistaates Sachsen. 2008 bis 2011 stand er dem Vorstand der Sächsischen Jugendstiftung vor. Er ist u. a. Mitglied des Fachausschusses Kultur der Deutschen UNESCO-Kommission und des Kulturausschusses im Deutschen Städtetag. »Eine Stadt ist ein kultureller Organismus, den man nur ganzheitlich und folglich partizipativ weiterentwickeln kann.«

Thomas Krüger *1959, ist seit Juli 2000 Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Von 1991 bis 1994 war er Senator für Jugend und Familie in Berlin, anschließend von 1994 bis 1998 Mitglied des Deutschen Bundestags. Bereits seit 1995 ist er Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes. Außerdem ist er zweiter stellvertretender Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz und Mitglied des Kuratoriums für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten.

Prof. Dr. Armin Nassehi ist Professor für Soziologie am Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er wurde 1960 in Tübingen geboren und wuchs in München, Landshut, Teheran und Gelsenkirchen auf. Er studierte von 1979 bis 1985 Erziehungswissenschaften, Philosophie und Soziologie an der Universität Münster sowie an der Fernuniversität in Hagen. Anschließend war er von 1986 bis 1988 Stipendiat der Universität Münster. Von 1988 bis 1994 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Münster. 1992 wurde er in Soziologie mit der Arbeit »Die Zeit der Gesellschaft« promoviert, 1994 folgte die Habilitation. Anschließend lehrte er von 1994 bis 1997 als Privatdozent an der Universität Münster. Nach Lehrstuhlvertretungen in Münster und München übernahm er 1998 den Lehrstuhl I für Soziologie an der Ludwigs-Maximilians-Universität München. Im Jahre 2012 wurde Nassehi durch das Interkulturelle Dialogzentrum in München mit dem IDIZEM-Dialogpreis ausgezeichnet. Im Jahre 2018 erhielt er von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie den Preis für Herausragende Leistungen auf dem Gebiet der »öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie«. Für 2021 wurde ihm der Schader-Preis zugesprochen. 2022 war er Mitgründer des PEN Berlin.

Turbo Pascal entwickelt interaktive Performances, die das Theater zum Versammlungs- und Verhandlungsraum gesellschaftlicher Prozesse, Dynamiken und Utopien machen. Zudem realisiert das Kollektiv, partizipative Projekte mit Bürger*innen oder Jugendlichen und konzipiert Gesprächs- und Kommunikationsformate für Tagungen und Festivals. Seit 2008 hat das Kollektiv seinen Sitz in Berlin und arbeitet sowohl in der freien Szene als auch an Stadt- und Staatstheatern. 2018 wurde Turbo Pascal mit dem George-Tabori-Förderpreis ausgezeichnet. Die Produktion »Unterscheidet Euch!« wurde 2019 mit dem Ikarus-Preis der Stadt Berlin ausgezeichnet und zum Impulse Festival 2020 eingeladen.
Carolin Amlinger, PostDoc-Assistentin am Deutschen Seminar, Universität Basel
Ingolfur Blühdorn, Professor für Soziale Nachhaltigkeit und Leiter des Instituts für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit, WU Wien
Mirjam Wenzel, Direktorin, Jüdisches Museum Frankfurt
Kulturpolitische Narrative – verstanden als sinnstiftende Erzählungen, die eng mit Emotionen und Werthaltungen verbunden sind – liefern Deutungsangebote und bieten Orientierung und Identität. Ihnen kommt in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzung, gesellschaftlicher Umbrüche und bedrohter Demokratie eine besondere Bedeutung und auch Wirkmacht zu.
Welche Leitbilder sind aktuell weit verbreitet? Von wem und warum? Welche Rolle spielt Polarisierung in diesen Leitbildern? Welcher Umgang mit Narrativen kann in Zeiten »alternativen Fakten« gefunden werden? Haben die aktuellen Leitbilder das Potential, Orientierung zu geben? Welche konkrete Relevanz haben sie in der Kultur, Kulturpolitik, kultureller und politischer Bildung sowie in der künstlerischen Praxis?
Ziel von Panel I ist die Auseinandersetzung mit der Funktion von Narrativen, dem Status quo und der Rolle von Kulturpolitik, kultureller und politischer Bildung sowie künstlerischer Praxis bei der Aushandlung von Narrativen und ihrer Umsetzung.

Muchtar Al Ghusain *1963, studierte Klavier und Kulturmanagement an den Musikhochschulen in Würzburg und Hamburg. Ab 1994 war er Musikschulleiter und ab 1998 zusätzlich Kulturamtsleiter in Schwäbisch Gmünd. Im Jahr 2000 wechselte er an das Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Hannover und war dort als Musikreferent und als Referent für die Kunsthochschulen tätig. Ab 2006 war er als Dezernent für die Bereiche Kultur, Schule und Sport in Würzburg zuständig. Seit 2018 ist er bei der Stadt Essen Dezernent für die Bereiche Jugend, Bildung und Kultur. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Kultur- und die Schulentwicklungsplanung, Kulturelle Bildung, Erinnerungskultur sowie Dritte-Orte-Transformationsprozesse. Er ist Vorstandsmitglied der Kulturpolitischen Gesellschaft. Als Musiker tritt Muchtar Al Ghusain vorwiegend als klassischer Pianist auf und vertont zudem Gedichte bekannter Autorinnen und Autoren zu eigenen Songs.

Dr. Carolin Amlinger ist Literaturwissenschaftlerin und Soziologin. Derzeit arbeitet sie als PostDoc-Assistentin am Deutschen Seminar der Universität Basel. Nach dem Studium der Soziologie, Germanistik und Philosophie an der Universität Trier wurde sie 2020 mit der mehrfach ausgezeichneten Arbeit »Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit« (Suhrkamp 2021) an der TU Darmstadt und dem Institut für Sozialforschung Frankfurt a. M. promoviert. 2022 erschien ihr Buch »Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus« (Suhrkamp) zusammen mit Oliver Nachtwey, das 2023 für den Preis der Leipziger Buchmesse (Sachbuch) nominiert war. Sie forscht zu Fragen gesellschaftlicher Polarisierung, zu Kultur und Ungleichheit und über Verschwörungstheorien. Daneben ist sie in der Jury des Lessing-Preises für Kritik. 2023 wurde sie mit dem Young Thinker-Award der Zeitschrift politik & kommunikation ausgezeichnet (Kategorie Gesellschaft/Soziologie).

Prof. Dr. Ingolfur Blühdorn ist Professor für Soziale Nachhaltigkeit und Leiter des Instituts für Gesellschaftwandel und Nachhaltigkeit (IGN) an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er studierte an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und promovierte an der University of Keele in Großbritannien. Über 20 Jahre forschte und lehrte er an der University of Bath (GB).
Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Theorie und Transformation moderner Gesellschaften, politische Soziologie, umweltpolitische Theorie, Demokratieforschung und Bewegungsforschung, insbesondere in Bezug auf öko-emanzipatorische Bewegungen seit den frühen 1970er Jahren. Nach verschiedenen internationalen Gastprofessuren wurde er 2015 auf den neu eingerichteten Lehrstuhl für Soziale Nachhaltigkeit an die WU Wien berufen. In deutscher Sprache zuletzt erschienen: Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit. Warum die ökologische Transformation der Gesellschaft nicht eintritt (2020, Transcript Verlag); Unhaltbarkeit. Auf dem Weg in eine andere Moderne (2024, Suhrkamp Verlag).

Prof. Dr. Mirjam Wenzel studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Politik- und Theaterwissenschaft in Berlin und Tel Aviv. Im Anschluss arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsche Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte dort zum deutschsprachigen Holocaust-Diskurs der sechziger Jahre. Mirjam Wenzel ist Autorin und Mitherausgeberin von Büchern und Ausstellungskatalogen zur deutsch-jüdischen Kunst- und Kulturgeschichte. Zudem ist sie kuratorisch tätig und konzipierte mehrere internationale Ausstellungen. Von 2007 bis 2015 verantwortete sie als Leiterin der Medienabteilung die Vermittlung jüdischer Geschichte und Kultur in digitalen und gedruckten Medien am Jüdischen Museum Berlin. Sie gilt seither als eine international anerkannte Expertin für Fragen der digitalen Transformation von Museen. Seit 2016 leitet Mirjam Wenzel das Jüdische Museum Frankfurt – das älteste jüdische Museum der Bundesrepublik Deutschland. 2019 wurde sie zur Honorarprofessorin am Seminar für Judaistik der Goethe-Universität Frankfurt am Main und im Wintersemester 2020/21 zur Gastprofessorin an der Bauhaus-Universität Weimar ernannt.
Die sieben parallelen Foren bieten die Gelegenheit, in kleinen Gruppen sehr praxisorientiert – aus den Perspektiven von lokalen bis internationalen Akteuren aus Kultur, Kulturpolitik und kultureller sowie politischer Bildung – die Auseinandersetzung mit aktuellen Narrativen fortzusetzen und durch sowohl Good als auch Bad Practice voneinander zu lernen und Anregungen für die eigene Arbeit zu erhalten – auch zum Umgang mit Polarisierung.
Zahlreiche Foren wurden aus dem Open Call besetzt.
Nicola Wenge, Wiss. Leitung und Geschäftsführung, Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e.V. - KZ-Gedenkstätte
Michaela Stoffels, Referentin für Kultur und Bildung beim Deutschen Städtetag (Moderation)
Etliche Tatorte nationalsozialistischer Gewaltverbrechen sind heute Gedenkstätten. Sie erinnern in ihrer alltäglichen Arbeit an die Verfolgung, Diskriminierung und Ermordung von Menschen(-gruppen) und leisten historische Grundlagenarbeit in Form von wissenschaftlicher Forschung und Dokumentation. Damit sind sie als Bildungseinrichtungen wesentlicher Teil der politischen Stadtkultur.
Den KZ-Gedenkstätten kommt in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung besondere Bedeutung zu. So werden immer mehr Angriffe aus dem rechten Spektrum verzeichnet. Auch Rechtsextremisten scheuen sich offenbar nicht mehr, ihre Ideologie an diesen Gedenkorten offen kundzutun.
Wie verändern Formen gesellschaftlicher Polarisierung die Gedenkstättenarbeit? Und zu welchen Strategien und neuen Angeboten greifen die Einrichtungen in dieser Situation? Diese und ähnliche Fragen werden im Mittelpunkt des Austauschs stehen.

Prof. Dr. Jens-Christian Wagner , geb. 1966, studierte Geschichte und Romanische Philologie in Göttingen und Santiago/Chile. Nach der Promotion an der Universität Göttingen war er 2000 Gastwissenschaftler am Forschungsprogramm »Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus« (Berlin) und leitete von 2001-2014 die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora (Nordhausen) sowie anschließend die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und die Gedenkstätte Bergen-Belsen. Seit 2020 ist er Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sowie Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Universität Jena. Forschungsschwerpunkte: Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Folgen (insbesondere Konzentrationslager und Zwangsarbeit), Erinnerungskulturen nach 1945, rechtsextremer Geschichtsrevisionismus. Wagner ist Autor zahlreicher Publikationen und Ausstellungen zu diesen Themen.

Dr. Nicola Wenge ist Historikerin und Wissenschaftliche Leiterin und Geschäftsführerin des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg Ulm e.V. – KZ-Gedenkstätte (DZOK). Sie hat einen Lehrauftrag am Institut für geschichtliche Landeskunde der Universität Tübingen. Ihr Studium der Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaften in Köln schloss sie mit der Dissertation »Zwischen Integration und Ausgrenzung. Eine jüdisch-nichtjüdische Beziehungsgeschichte Köln 1918-1933« ab, die mit Preisen der Universität zu Köln und des Landschaftsverband Rheinland ausgezeichnet wurde. Anschließend war sie zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin am NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln tätig und ist seit 2009 Leiterin des DZOK.
Sie verfasste mehrere Veröffentlichungen zur Geschichte des Nationalsozialismus, Antisemitismus und Erinnerungskultur nach 1945 und ist Herausgeberin einer Schriftenreihe, didaktischer Materialien und eines Halbjahresperiodikums des DZOK. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Gedenkstättenbeirat des Landes BW, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und der AG Gedenkstätten an Orten früher Konzentrationslager.

Dr. Michaela Stoffels *1970, ist Referentin für Kultur und Bildung beim Deutschen Städtetag. Ein Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich Erinnerungskultur / städtische Gedächtniseinrichtungen. Nach ihrem betriebswirtschaftlichen Studium und der Promotion in Neuerer Geschichte / Kunstgeschichte (Universität zu Köln) war sie 2008 bis 2019 als Studienleiterin für Kunst und als Grundsatzreferentin für Integration tätig. Parallel hat sie den Aufbaustudiengang Kulturmanagement (PH Ludwigsburg) sowie den Studiengang Kunstkritik & Kuratorisches Wissen (Universität Bochum) absolviert.
Robert von Zahn, Generalsekretär des Landesmusikrats NRW
Birgit Mandel, Geschäftsführende Direktorin, Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim (Moderation)
Die aktuelle Spaltung der Bevölkerung nach politischen Grundorientierungen, Herkünften und Lebensstilen, die zunehmend den demokratischen Diskurs und die Verständigung erschwert, spiegelt sich auch im Publikum kultureller Angebote wider. Vor allem die staatlich geförderten Kultureinrichtungen werden überwiegend von einer sozial eher homogenen Gruppe von Menschen mit höherem formalen Bildungsniveau und gehobenem sozialen Status besucht.
Wie kann es in einer stark polarisierten Gesellschaft, wo die verschiedenen Gruppen sich kaum mehr zuhören, gelingen, Menschen über Kunst und Kultur zusammen zu bringen, die sich sonst nicht mehr begegnen? Mit welchen künstlerisch-kulturellen Angeboten lassen sich Menschen unterschiedlicher Lebensstile und politischer Auffassungen gleichzeitig erreichen? Wie müssen Orte und Angebote gestaltet sein und kommuniziert werden, um die Gesellschaft in ihren verschiedenen Wahrheiten und ihrer Komplexität zu zeigen und gleichzeitig für viele relevant und einfach zugänglich zu sein?
Antworten auf diese Fragen werden mit Leitungen kultureller Einrichtungen und den Teilnehmenden des Forums erarbeitet.

Dr. Christian Esch Nach seiner musikwissenschaftlichen Promotion arbeitete er als fester Musiktheater- und Schauspieldramaturg, später auch frei. Von 1994 bis 2003 entwickelte und verantwortete er als Produzent und Redakteur für den Hessischen Rundfunk landesweite Konzerte, programmierte besondere Konzertformate, produzierte CD-Einspielungen und moderierte Sendungen. Esch war langjähriger Musikbeirat des Goethe-Instituts. Seit 2004 ist er Direktor des NRW KULTURsekretariats, war zugleich als Berater für kommunale Kulturentwicklungsplanung tätig und wirkt im Vorstand des Kulturrats NRW mit, ebenso wie im Kuratorium der Akademie für Theater und Digitalität und in zahlreichen Jurys. Digitalität und experimentelles Musiktheater zählen zu seinen Schwerpunkten. Seit 2021 ist er Gründungsvorsitzender der »Initiative für die Kultur in Deutschland e.V.«, die jährliche bundeweite »Kultur gibt«-Aktionstage ausrichtet.2013 erhielt Esch den Grimme Online Award. 2023 wurde er von CEO Monthly als »Most Innovative Arts & Culture Chairman 2023 (Germany)« benannt.

Prof. Dr. Robert von Zahn studierte Musikwissenschaft, Geschichte und Anglo-Amerikanische Geschichte in Köln. Dissertation über Hamburgische Musikgeschichte um 1800. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Archiv der Stadt Köln 1990-1993, am Joseph Haydn-Institut Köln 1993-2005 und Generalsekretär des Landesmusikrats NRW seit 2005. Honorarprofessur an der Folkwang Universität der Künste, Essen. Publikationen über Joseph Haydn, Jazzgeschichte, Alte Musik, Neue Musik nach 1945 und Kulturgeschichte Nordrhein-Westfalens. Drei Bände in der Gesamtausgabe »Joseph Haydn Werke«.

Prof. Dr. Birgit Mandel ist Professorin für Kulturvermittlung und Kulturmanagement am Institut für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim und leitet den Masterstudiengang Kulturvermittlung. Von 2015-2022 war sie Vizepräsidentin der Kulturpolitischen Gesellschaft. Sie ist Kuratoriumsmitglied der Commerzbank Stiftung, für die sie den Preis „ZukunftsGut“ für institutionelle Kulturvermittlung entwickelt hat, sowie Aufsichtsratsmitglied der Berlin Kulturprojekte GmbH. Sie hat diverse Forschungsprojekte an der Schnittstelle von Kulturvermittlung, Audience Development, Kulturmanagement und Kulturpolitik sowie Besucherstudien und Bevölkerungsbefragungen durchgeführt.
Alissa Krusch, Managerin Digitale Transformation, Kulturforum Witten
Marie Schallenberg, Marketing und Kommunikation, Kulturforum Witten
Romy Schmidt, Kulturförderung, Kulturforum Witten
Dieser Workshop widmet sich im Geflecht aus Demokratie, Macht und Storytelling den konkreten Erfahrungen der kommunalen Kulturarbeit: Wie kann Vergemeinschaftung eine inklusive und gerechte Demokratie stärken und uns dabei helfen, umzusetzen, was uns antreibt: Kultur für alle zu ermöglichen!?
Getragen von Commons als Schlüssel gesellschaftlichen Wandels ist das Spielfeld das System: Anhand der Werteentwicklung im Kulturforum Witten veranschaulichen wir die bereits gefundenen Spielräume innerhalb des Systems und öffnen uns dem Diskurs über die Zerrissenheit der Gegenwart, den Aufbau widerständiger Strukturen und über gelebte Praktiken der offenen und diversen Gesellschaft.
Der Praxisteil ist eine lebendige Reflexion über Macht. Im Anschluss erörtern wir die Frage, wie kulturpolitische Narrative in konkrete Handlungen einer Organisation überführt werden
können.

Joscha Denzel ist Kulturschaffender und Musiker. Er studierte Physik in Bochum. Seine Projekte bewegen sich an der Schnittstelle von Kultur und Stadtentwicklung. Seit 2023 arbeitet er für das Kulturforum Witten für »Placemaking und künstlerische Entwicklung« und ist zuständig für die Neuentwicklung des Bespieltheaters Saalbau in baulicher, künstlerischer und gemeinwohlorientierter Perspektive. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht dabei die Frage, wie Kultur gesellschaftlichen Wandel vorantreiben kann.

Alissa Krusch ist als Managerin für Digitale Transformation im Kulturforum Witten seit 2021 für den digitalen Wandel der Organisation zuständig, der neben dem Blick auf innere Strukturen auch die nach außen sichtbaren Projekte wie das Digitallabor oder das Fellowship für urbane Digitalkultur umfasst. Die Medienwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin arbeitet seit 15 Jahren mit Überzeugung in großen, öffentlich getragenen Einrichtungen und hat sich den dringend notwendigen (digitalen) Wandel von Organisationen zum Thema gemacht. Als Kommunikationsmensch glaubt sie an die gestaltende Kraft von Worten und Bildern und Geschichten.
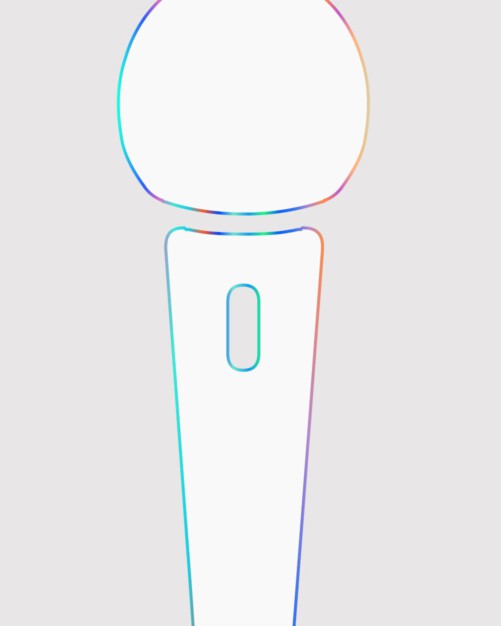
Marie Schallenberg kommt ursprünglich aus dem Veranstaltungsbereich und entdeckte dort ihre Leidenschaft für Kommunikation. Sie studierte Wirtschaft und Kommunikation in Essen und verantwortet seit 2021 im Kulturforum Witten die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mit Empathie und dem Gespür für kommunikative Bedürfnisse treibt sie interne und externe Themen kommunikativ voran. Als »Kulturforums-Eigengewächs« und der damit verbundenen langjährigen Betriebszugehörigkeit bringt sie dabei eine besondere Perspektive auf die Veränderungen innerhalb der Organisation und ihre Auswirkungen auf die Menschen und Strukturen mit.

Romy Schmidt ist Kuratorin und Akteurin in den freien darstellenden und bildenden Künsten und arbeitet recherchebasiert im Umfeld von Tanz, Medienkunst und Sound Design. Ihre Arbeit fokussiert die Fragen um Sichtbarkeit und Repräsentation außereuropäischer, diasporischer und (p)ostdeutscher Narrative in Kultur und Medien sowie neue Formen multiperspektivischer Erzählungen. Seit 2024 arbeitet sie im Bereich Kulturförderung im Kulturforum Witten an der Schnittstelle zur freien Szene, initiiert künstlerische Kooperationen und leistet Konzeptionsberatung.
Wiebke Zetzsche, Koordination kulturelle Bildungsprojekte, LJKE Bayern e.V.
Die Vielzahl der gesellschaftlichen Herausforderungen überfordert und verleitet dazu, Antworten in unterkomplexen und schematischen Denk- und Handlungsmustern zu suchen.
Im kollaborativen Kreativlabor wollen wir neue, vielleicht auch irritierende Wege ausprobieren, um Komplexität zuzulassen und Polarisierung ein Stück weit zu überwinden. Die Teilnehmenden am Shortcut plan_los werden selbst zu Planenden und Gestaltenden eines Prozesses, der die Grundsätze kultureller Bildung wie Prozesscharakter, Improvisation und Ergebnisoffenheit anwendet und so Raum für Irritation, für Ambiguitätstoleranz, Hybridität und Vielschichtigkeit schafft.
Abschließend gleichen wir die Erkenntnisse aus unserem shortcut-Workshop mit den Erfahrungen des ideengebenden plan_los-Prozesses ab, den wir im Mai im Rahmen der bayerischen Jugendkunstschultage durchgeführt haben. Es wird interaktiv, kreativ und experimentell und wir verlassen – im wahrsten Sinne des Wortes – unseren Komfortbereich!

Sabine Eitel

Wiebke Zetzsche
Karin Peter, Stellvertretende Amtsleiterin für Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung Landkreis Vorpommern-Greifswald
Mathias Roloff, Bildender Künstler Dorfresidenz Hintersee (M-V) 2023
Als Dorfbewohner*in haben Sie bemerkt, dass das Zusammenleben in der Gemeinschaft besser sein könnte und Sie fragen sich, ob es möglich ist, mit Angeboten im Bereich Kunst und Kultur etwas daran zu ändern. Dazu wird Hilfe von professionellen Künstlern*innen nötig sein. Welche*n Künstler*in würden Sie in Ihre Gemeinde einladen, um gemeinsam Kunstprojekte umzusetzen, und welche Erwartungen verbinden Sie damit? Diese Fragen stellen sich Bewohner*innen in den Ortsjurys im Format „Dorfresidenz“ des Kulturlandbüros bei ihrer Auswahl. Der Workshop führt die Teilnehmenden durch alle sieben Phasen des prozessorientierten, partizipativen Kunstformates im südöstlichen Mecklenburg-Vorpommern.
Wir laden die Teilnehmer*innen im ersten Schritt ein, einen Perspektivwechsel zu vollziehen: Eine Gruppe denkt sich mögliche partizipative Kunstprojekte für unseren spezifischen ländlichen Raum aus. Anschließend stellt sie diese der anderen Gruppe vor. Dort sind die Stimmen der Einwohner*innen in einer Ortsjury versammelt, die anhand selbst gesetzter Kriterien eine Auswahl trifft. So begann jede der mittlerweile 8 Dorfresidenzen, die das Kulturlandbüro in 12 Gemeinden seit 2021 im Landkreis Vorpommern-Greifswald umgesetzt hat. Im zweiten Schritt ordnen Mathias Roloff, ehemaliger Dorfresidenzkünstler, David Adler, Leiter des Kulturlandbüros, und Karin Peter aus dem Amt für Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung Landkreis Vorpommern-Greifswald, die geäußerten Ideen aus der Perspektive der Kunstschaffenden und der Gemeinde ein. Im dritten Schritt nehmen wir Sie mit auf die Reise bis zum Abschluss einer Dorfresidenz und darüber hinaus. Dabei gehen wir auf Basis unserer Erfahrung insbesondere auf die vielen kleinen Transformationselemente ein, durch die solche Projekte Polarisierungen zwischen Alteingesessenen und Neuzugezogenen, zwischen Jung und Alt sowie Pol*innen und Deutschen überwinden helfen.

David Adler wurde 1979 in Greiz geboren und studierte Philosophie, Musikwissenschaften und Psychologie in Halle (Saale), sowie Betriebswirtschaft in Hagen. Er war als Kulturmanager u.a. tätig beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, bei der Haydn Sinfonietta Wien, bei den Berliner Festspielen, als Persönlicher Referent des Intendanten am Theater Vorpommern und als Verwaltungsleiter bzw. –direktor an den Theatern Baden-Baden und Bremen. Seit 2020 ist David Adler Leiter des Kulturlandbüros, das sich vor allem der Konzeption und Umsetzung partizipativer Kunstformate in ländlichen Räumen widmet. Außerdem ist er als Moderator, Workshopleiter, Kulturwissenschaftler und Musiker aktiv.

Karin Peter lebt auf der Ostsee-Insel Usedom und studierte an der Universität Greifswald. Als Diplomlehrerein für Geographie und Mathematik beschäftigte sie sich mit der Entwicklung des Tourismus auf der Insel Usedom. Seit 1985 ist sie in der öffentlichen Verwaltung im Bereich der Kulturförderung tätig. Nach der politischen Wende wurde sie Sachgebietsleiterin für den Bereich Kultur im Kreis Wolgast bzw. den späteren Landkreis Ostvorpommern, verbunden mit Tätigkeiten in den Bereichen Tourismus, Denkmalpflege, Archiv, Sportförderung und regionaler EU-Förderung. Im Jahre 2005 machte sie ihren Berufsabschluss als Verwaltungsfachwirtin und von 2008-2011 war sie außerdem als Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Ostvorpommern tätig. Von 2011 bis 2013 übernahm sie die Leitung des Bundesprojektes »Lernen vor Ort« im neu gebildeten Landkreis Vorpommern-Greifswald. Seit 2014 ist sie stellvertretende Amtsleiterin und Sachgebietsleiterin für die Bereiche Bildung, Kultur und Schulentwicklungsplanung im Landkreis. Dieser breite Aufgabenbereich und damit verbundene langjährige Lokalkenntnisse ermöglichten ihr, ein Netzwerk von Akteuren und Akteurinnen vielfältigster Ausrichtungen innerhalb der Landkreisverwaltung wie außerhalb der Verwaltung zu knüpfen, deren gemeinsames Interesse in einer bildungs- und kulturorientierten Regionalentwicklung besteht.

Mathias Roloff wurde 1979 in Berlin geboren. Sein Studium der Malerei und Grafik an der Universität der Künste Berlin schloss er 2006 als Meisterschüler von Prof. Volker Stelzmann ab. Seitdem ist er als freischaffender Künstler tätig. Seine Werke wurden in nationalen und internationalen Ausstellungen präsentiert und sind in verschiedenen öffentlichen Sammlungen und Bibliotheken vertreten.
Neben der bildkünstlerischen Arbeit engagiert er sich als Mitglied im Kulturbeirat des Bezirksamtes Lichtenberg zu Berlin und realisierte zahlreiche partizipative Projekte in den Bereichen Soziokultur und Kulturelle Bildung. 2023 führte er in Hintersee (M-V) eine Dorfresidenz in Kooperation mit dem Kulturlandbüro Uecker-Randow durch.
Przemysław Sadura, Professor of Sociology, University of Warsaw
Gosia Wochowska, Project manager and external expert for EACEA and REA, an activist for women's rights, Poland/Germany
Jochen Butt-Pośnik, Head of the National Contact Point of the EU Programme »Citizens, Equality, Rights and Values« (Moderation)
In October 2023, the Polish opposition won the majority in the Sejm and ended the 8 years of the right-wing populist party PiS in power. Since then, the parties which form the new government struggle to wind back the dependence of institutions such as the courts and the public media. But institutions (and the resistance of the PiS-leaning president) is just the one side: PiS still has the biggest support of voters of all parties, especially at the countryside. How to win back these voters who consumed state-led propaganda of the EU as a thread to the national sovereignty just as Russia is? What could be learned by the Polish example when it comes to what should have been done preventively beforehand to make institutions resilient against ultra-right capture? Can legal foundations, e.g. in the promotion of culture, set and protect democratic values and human rights that then prevent the right-wingers from dragging them down once they have seized power? What is and was the role of civil society organisations who accompanied the PiS government with demonstrations against the backlash in women rights and undermining of rule and law?
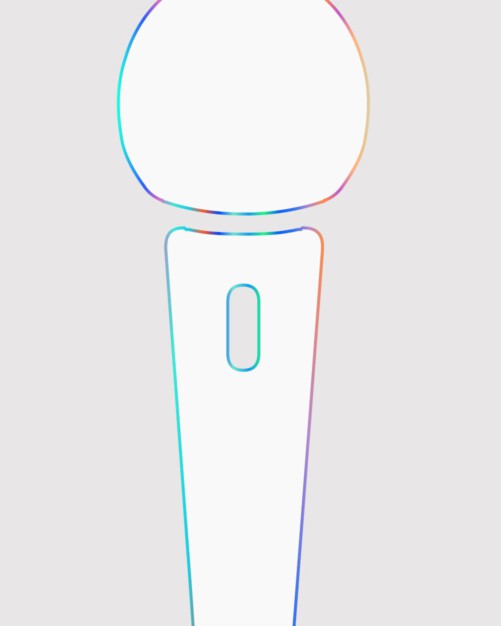
Magdalena Gałkiewicz

Prof. Dr. Przemysław Sadura is a professor in the Department of Sociology at the University of Warsaw. He is also the founder, former president and now chief expert of the »Field of Dialogue« polish NGO established with the aim of supporting public participation and facilitating dialogue. He is a member of the editorial team of Krytyka Polityczna (Political Critique) and head of the research institute of Political Critique. His fields of interest are sociology of politics, sociology of education and the social inequalities.

Gosia Wochowska PhD, a Project Manager specialized in building and sustaining large-scale thematic networks of European towns across the EU. An External Expert of CERF Programme and Horizon Europe for EACEA and REA (monitoring and evaluation). An activist for women’s reproductive rights, operating transnationally. She wrote a PhD on European Union policies regarding European Citizenship and analyzed their impact on local and regional authorities and on European civil society. She is a committee Member of a European Citizens‘ Initiative (ECI) „I’m going European“ which advocates for a European dimension of civic education, i.e. that every child in the EU have a right to knowledge of the EU and their European rights, and that every person have a once-in-a-lifetime opportunity to experience what Europe has to offer. She comes from Poland and since 2019 has lived in Germany.

Jochen Butt-Pośnik is the head of the National Contact Point of the EU Programme »Citizens, Equality, Rights and Values« (CERV 2021 – 2027) in Germany. With his team he informs and advises potential applicants of the programme, supports in project development and international partner finding for projects in themes such as equality, anti-discrimination, remembrance, town-twinning etc. The carpenter and social scientist has been active for a long time in the European youth field and strongly relates with topics like youth participation and civic education. He was co-founder of the non-profit consulting office »Profondo« in Hannover/Germany and is a free-lance facilitator and moderator.
Milo Rau, Intendant, Wiener Festwochen
Philipp Staab, Professor für Soziologie von Arbeit, Wirtschaft und technologischem Wandel, HU Berlin und Co-Direktor, Einstein Center Digital Future
Julia Wissert, Intendantin, Schauspiel Dortmund
Braucht es neue Leitbilder für die Zukunft? Vor dem Hintergrund welcher Ziele und welcher gesellschaftspolitischen Visionen? Post-Polarisierung? Welche Ansätze und Beispiele gibt es für neue Leitbilder? Inwieweit bedarf es einhergehend mit neuen Narrativen auch neuer Formen des Denkens, Fühlens und kollektiven Handelns? Wo sind Handlungsspielräume und Grenzen? Welche Potenziale – aber auch welche Verantwortung – haben Akteure der Kultur, Kulturpolitik und kulturellen sowie politischen Bildung bei den Aushandlungsprozessen und der konkreten Ausgestaltung? Welche Partnerschaften begünstigen die Umsetzung?
Ziel des zweiten Panels ist es, potentielle neue Leitbilder für die Zukunft zu thematisieren – ihre Notwendigkeit zu diskutieren, Impulse für neue Ansätze vorzustellen, ihren möglichen Beitrag zur Überwindung von Polarisierung zu erörtern und die Rolle von Kultur, Kulturpolitik und kultureller sowie politischer Bildung in Aushandlungsprozessen und ihren Umsetzungen zu diskutieren.

Prof. Dr. Sabine Hark Professor*in für Geschlechterforschung und Leitung des Zentrums für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (ZIFG) an der TU Berlin. Mitherausgeber*in der Zeitschrift feministische studien. Zeitschrift für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Aktuelle Publikationen: Die ungleiche Universität. Diversität, Exzellenz und Antidiskriminierung , Wien 2023 (zusammen mit Johanna Hofbauer); Gemeinschaft der Ungewählten. Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation, Berlin 2021; Unterscheiden und herrschen. Ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart, Bielefeld 2017 (zusammen mit Paula-Irene Villa).

Milo Rau *1977, ist Regisseur, Autor und Dozent und war Intendant des NTGent (Belgien). Rau studierte Soziologie, Germanistik und Romanistik in Paris, Berlin und Zürich u.a. bei Pierre Bourdieu und Tzvetan Todorov. Seit 2002 veröffentlichte er über 50 Theaterstücke, Filme, Bücher und Aktionen. Seine Theaterproduktionen waren bei allen großen internationalen Festivals zu sehen, darunter das Berliner Theatertreffen, das Festival d’Avignon, die Biennale Venedig, die Wiener Festwochen und das Brüsseler Kunstenfestivaldesarts und tourten durch über 30 Länder weltweit. Rau hat mehrere Auszeichnungen erhalten, u. a. den 3sat-Preis 2017, die Saarbrücker Poetik-Dozentur für Dramatik 2017 und 2016 als jüngster Künstler nach Frank Castorf und Pina Bausch den renommierten ITI-Preis des Welttheatertages. 2017 wurde er bei der Umfrage der Deutschen Bühne zum Schauspielregisseur des Jahres gewählt, 2018 erhielt er für sein Lebenswerk den Europäischen Theaterpreis und war 2019, als erster Künstler überhaupt, Associated Artist der European Association of Theatre and Performance (EASTAP). 2020 erhielt er für sein künstlerisches Gesamtwerk die renommierte Münsteraner Poetikdozentur. Seine Stücke wurden in über 10 Ländern in Kritikerumfragen zu den besten des Jahres gewählt. Im Jahr 2019 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Lund in Schweden, 2020 wurde er Ehrendoktor der Universität Gent. Seit 1. Juli 2023 ist Milo Rau Intendant der Wiener Festwochen.

Prof. Dr. Philipp Staab *1983 in Nürnberg, ist Professor für Soziologie Arbeit, Wirtschaft und technologischem Wandel an der Humboldt-Universität zu Berlin und Co-Direktor am Einstein Center Digital Future. In seiner Forschung verbindet er Themen der Arbeit, Sozialstrukturanalyse, Techniksoziologie und politischen Ökonomie in gegenwartsanalytischer Absicht. Aktuell befasst er sich insbesondere mit Fragen der politischen Gestaltung des digitalen Kapitalismus, des Zusammenhangs von Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie der Rolle kritischer Infrastrukturen für die Zukunftsfähigkeit moderner Gesellschaften. Zuletzt erschien von ihm im Suhrkamp Verlag das Buch »Anpassung. Leitmotiv der nächsten Gesellschaft«.

Julia Wissert ist seit der Spielzeit 2020/21 Intendantin des Schauspiel Dortmund und freie Regisseurin in den Bereichen Schauspiel, Musiktheater und Film. Ihre performativen Ansätze, aus der Londoner Zeit, verbanden sich durch ein verstärktes Interesse an Texten zu eigenen interdisziplinären Formen zwischen Sparten und Genres. Für ihre Arbeiten gewann sie den Publikumspreis des Körber Studio Junge Regie, den Preis der Stadt Salzburg und den Kurt-Hübner-Regiepreis.
Julia Wissert arbeitete unter anderem am Nationaltheater Brno, dem Schauspielhaus Bochum oder dem Staatstheater Hannover. Neben ihrer Arbeit als künstlerische Leiterin und Regisseurin schreibt sie Texte zu strukturellem Rassismus und der Transformation im Theater. Durch die kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsumfeld, in dem sie sich als Künstlerin bewegt, folgten Artikel und Vorträge.
2017 entwickelten die Anwältin Sonja Laaser und Julia Wissert die »Anti-Rassismus-Klausel«. Im Sommersemester 2023 ist Julia Wissert Gastprofessorin an der UDK in Berlin im Bereich Kunst im Kontext. Julia Wissert ist Mitglied der Deutschen Akademie der darstellenden Künste.
Ziel dieses interaktiven Formates ist es, in sieben parallelen Kleingruppen gemeinsam neue Leitbilder, Narrative und Praktiken des Miteinanders für KulturpolitikEN der Zukunft unter Einbeziehung von Kunst, kultureller und politischer Bildung zu entwickeln. Hierbei sollen insbesondere auch die Perspektiven und Bedarfe von Kulturpolitiker*innen vor Ort berücksichtigt werden. Die Ergebnisse dieser Foren werden anschließend im Plenum vorgestellt.
Zahlreiche Foren wurden aus dem Open Call besetzt.
Natasha A. Kelly, Kommunikationswissenschaftlerin, Autorin und Politikerin (angefragt)
Şeyda Kurt, Journalistin und Autorin (Moderation)

Fabian Burstein , geboren 1982 in Wien, Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Im Autorenleben Verfasser von Romanen und Sachbüchern. Biograf der österreichischen New-Wave-Legende Hansi Lang. Seit mehr als 10 Jahren vorwiegend in Deutschland als Leiter für Kulturinstitutionen, Festivals und diverse künstlerische Formate verantwortlich. Zuletzt in der Edition Atelier erschienen:
»Eroberung des Elfenbeinturms. Streitschrift für eine bessere Kultur« (2022).
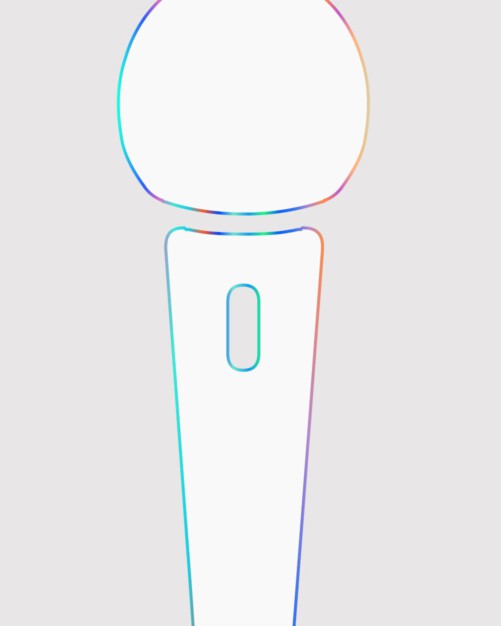
Natasha A. Kelly

Şeyda Kurt studierte Philosophie, Romanistik und Kulturjournalismus und ist Publizistin und Moderatorin. Im Verlag HarperCollins Germany erschienen ihre beiden Sachbuchbestseller »Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist« (2021) und »Hass. Von der Macht eines widerständigen Gefühls« (2023). Sie ist Autorin im Politischen Feuilleton des Deutschlandfunk Kultur und schrieb Kolumnen für das Theaterfeuilleton nachtkritik.de sowie für das Buchjournal. 2024 erschien der Sammelband »Spiel*Kritik. Kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus«, den sie mit den Medienwissenschaftlern Thomas Spies und Holger Pötzsch herausgegeben hat.
Florence Thurmes, Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz
Christina Stausberg, Hauptreferentin für Kultur des Deutschen Städtetags
Kurt Eichler, Geschäftsführender Direktor der Kulturbetriebe Dortmund a.D. (Moderation)

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger ist seit 2008 Landesrätin und Kulturdezernentin beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Sie studierte Ur- und Frühgeschichte, Kunstgeschichte, Klassische Archäologie, Geologie und Paläontologie in Köln und Münster. Von 2003-2008 war sie Leiterin des LWL-Museums für Archäologie und Kultur in Herne, bevor sie 2008 die Leitung des LWL-Kulturdezernates übernahm. Als LWL-Kulturdezernentin ist sie zuständig für 18 Museen, 2 Besucherzentren, 7 Kulturdienste und 6 wissenschaftliche Kommissionen. Sie bündelt und koordiniert die Belange dieser Kultureinrichtungen und nimmt eine wichtige Rolle im Bereich der strategischen Kulturarbeit, Kulturförderungen und Kulturpartnerschaften in Westfalen-Lippe ein.
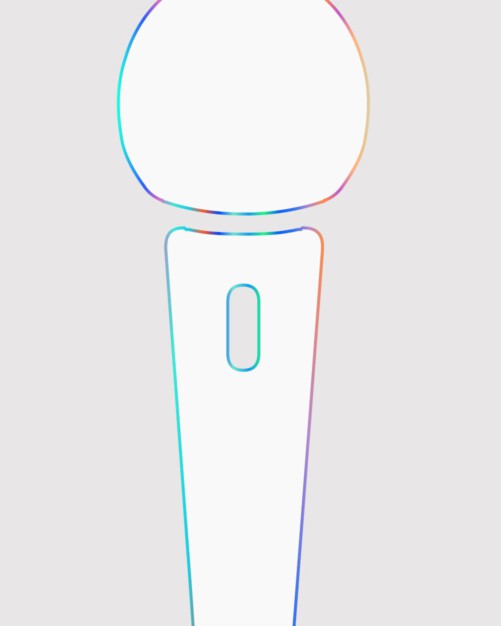
Dr. Florence Thurmes

Christina Stausberg *1967, ist Hauptreferentin für Kultur beim Deutschen Städtetag in Köln. Sie studierte Politikwissenschaften, Germanistik und Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Ihre Magisterarbeit bei Prof. Paul Kevenhörster befasste sich mit der Entwicklung rechtsextremer Parteien in der Bundesrepublik Deutschland. Nach zehnjähriger Tätigkeit in der kommunalen Praxis wechselte sie 2007 zu den kommunalen Spitzenverbänden. Dort war sie zunächst in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik tätig, bis sie 2017 in die Kulturpolitik wechselte.

Kurt Eichler Dipl.-Ing., (*1952), Studium der Raumplanung und Theaterwissenschaften in Dortmund, Bochum und Köln; bis 2017 Geschäftsführender Direktor der Kulturbetriebe Dortmund; Vorsitzender des Fonds Soziokultur, der LAG Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW, der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit Nordrhein-Westfalen sowie Vorstandsmitglied und Schatzmeister der Kulturpolitischen Gesellschaft; Arbeits- und Interessenschwerpunkte: Kulturförderkonzepte, Kulturentwicklungsplanung, Kulturverwaltungsreform, Kultur und Urbanität, Soziokultur, freie Kultur- und Theaterarbeit, Kinder- und Jugendkulturarbeit, Kulturelle Bildung, Agenda 21 für Kultur, europäischer/ internationaler Kulturaustausch.
Linda Weichlein, Facilitatorin und Strategieberaterin
Die Post-Polarisierung ist längst da – man muss nur richtig hinschauen! Sowohl in Deutschland als auch anderswo existieren bereits Leitbilder, die Differenz und Zugehörigkeit gleichzeitig feiern – jenseits ethno-nationalistischer »Leitkulturen«.
In diesem Workshop nehmen wir den status quo deshalb genauer unter die Lupe: Welche kulturpolitischen Narrative werden an anderen Orten der Welt entwickelt, welche Visionen von Post-Polarisierung verfolgen sie, wie und durch welche Akteur*innen? Wir wollen Antworten zeigen, die es schon gibt. Unsere Inspiration Library lädt dazu ein, internationale Best und Next Practice Beispiele (und vielleicht auch den ein oder anderen »epic fail«) für sich zu entdecken. Im Anschluss entwickeln wir eigene Entwürfe für kulturpolitische Empfehlungen und Forderungen neuer Leitbilder.

Kai Brennert ist Geschäftsführer von edgeandstory, einer Beratungsfirma für Evaluation, Forschung und Kulturpolitikberatung an der Schnittstelle zu Nachhaltigkeit und Entwicklung. Zu den Klienten gehören u.a. das kambodschanische Kulturministerium, das europäische Netzwerk für zeitgenössische Zirkuskunst Circostrada, British Council, UNESCO und MitOst/zusa. Kai studierte International Cultural Policy and Management (M.A.) an der University of Warwick, UK, und arbeitete sowohl im Kulturmanagement und Stiftungswesen als auch in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Er ist seit 2011 Mitglied der Kulturpolitischen Gesellschaft.➔ kaibrennert.me

Linda Weichlein ist freiberufliche Facilitatorin, Kulturmanagerin und angehende Humangeographin. Besonders interessiert sie sich für nachhaltige und gerechte Zusammenarbeit. Sie studierte Arts Administration & Cultural Policy (M.A.) am Goldsmiths College, UK, und arbeitete an den Schnittstellen von Standortentwicklung, Kultureller Bildung und Migrationsgesellschaft. Aktuell begleitet sie Teams und Gruppen durch die Moderation von Workshops dabei, gemeinsam Veränderung zu gestalten, einander zuzuhören und zu lernen.➔ lindaweichlein.com
Das Modellprojekt neue unentd_ckte narrative zeigt, wie mit Narrativen, Fiktionen mit den Mitteln von kulturellen Netzwerkprojekten Wege gefunden werden, um radikalisierende Diskurse in der Stadt Chemnitz zu bearbeiten. Der Workshop vermitteln Didaktik, Methoden und better practise Ansätze an konkreten Beispielen und lässt Sie aktiv selbst ausprobieren, diesen Ansatz zu übertragen.
Das Programm neue unentd_ckte narrative bastelt seit 2017 Erzählräume in Chemnitz, in denen Bürger:innen die Debatte unterteilen, einordnen, entwirren, bereichern und neu zusammenfügen können. Wir haben über zehn Kulturproduktionen und vier Festivals durchgeführt, Preise gewonnen, aber weitere kreative Prozesse angestoßen, entlang unterschiedliche Narrative und mit künstlerischen Praktiken, die die Themen unserer Zeit neu verhandelt.

Dr. Frauke Wetzel ist Kulturwissenschaftlerin, Kulturmanagerin und promovierte Osteuropahistorikerin. Sie arbeitete sechs Jahre in der Tschechischen Republik. Frauke Wetzel arbeitete für das Festival »Politik im Freien Theater« der Bundeszentrale für politische Bildung und war von 2013 bis 2020 für audience development, Vermittlung, Inklusion in HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden zuständig. Hier konzipierte sie u.a. das Diskursprogramm des Festivals RomAmoR und lehrt Audience Development an Hochschulen und berät die Freie Szene.
Derzeit arbeitet Frauke Wetzel beim Verein ASA-FF in Chemnitz leitet das Programm neue unentd_ckte narrative und berät Kulturproduktionen zu politischen Ansätzen und Diversitätsentwicklung.
Yotam Peled, Choreograph
Where the boys are, Tanz-Performer
JugendTanzCompany, fabrik Potsdam
Wir verbinden künstlerische und kulturpolitische Impulse und beziehen die Perspektive von Jugendlichen ein: Im Anschluss an die Aufführung des Pop Up-Tanzstücks Where the Boys Are von Yotam Peled, das in Zusammenarbeit mit Schüler*innen entstanden ist, diskutieren wir mit dem Produktionsteam, beteiligten Jugendlichen und Teilnehmenden über die Potenziale eines künstlerischen Ansatzes, der Themen und Bedürfnisse junger Menschen in den Blick nimmt: Inwiefern verändern junge Perspektiven bestehende Narrative und wie beeinflussen sie Schaffensprozess und künstlerisches Werk? Wie können sich Jugendliche mehr Gehör verschaffen und Einfluss auf die Veränderung gesellschaftlicher Leitbilder nehmen. Welchen Beitrag können Kultur und Kunst dazu leisten? Das Forum wird gestaltet vom bundesländerübergreifenden Netzwerk explore dance, das Kindern und Jugendlichen nachhaltig Zugang zu zeitgenössischem Tanz ermöglicht und damit die Sichtbarkeit dieser Kunstform dauerhaft stärkt.

Dr. Kerstin Evert studierte Angewandte Theaterwissenschaft (Gießen) und promovierte zum Thema DanceLab
– Zeitgenössischer Tanz und Neue Technologien. Von 2002 bis 2006 Dramaturgin auf Kampnagel,
gründete sie 2006 das choreographische Zentrum K3 | Tanzplan Hamburg, das sie seitdem leitet. Sie
ist im Vorstand und seit 2022 Kopräsidentin des European Dancehouse Network.

Yotam Peled ist in Israel geboren. Seit seiner Kindheit beschäftigt er sich mit bildender Kunst, Leichtathletik und Capoeira. Mit 21 Jahren begann er zu tanzen und absolvierte später eine Ausbildung im zeitgenössischen Zirkus. Seit 2015 lebt er in Berlin, wo er als freischaffender Performer arbeitet und eigene choreographische Arbeiten kreiert, die weltweit aufgeführt werden. Yotam Peled ist künstlerischer Leiter der Kompanie Yotam Peled & the Free Radicals.

Where the boys are
Andrius Nekrasoff, Performer
ist ein Bewegungsenthusiast mit litauischen Wurzeln. Er begann mit Trampolinturnen und klassischem Boxen. Seine Neugier und seine Suche nach Ausdrucksfreiheit führten ihn schließlich zur Kunst und zum zeitgenössischen Tanz.
Nicolas Knipping, Performer
ist Kampfkünstler und lebt in Berlin. Er verbrachte seine Jugend als olympischer Profiringer, arbeitete als Trainer und Bewegungspädagoge, absolvierte einen Bachelor in Sport und Wirtschaft, lernte ganzheitliche Bewegungslehre und studiert derzeit Innere Kampfkünste an der Xuan Gong Fu Akademie.
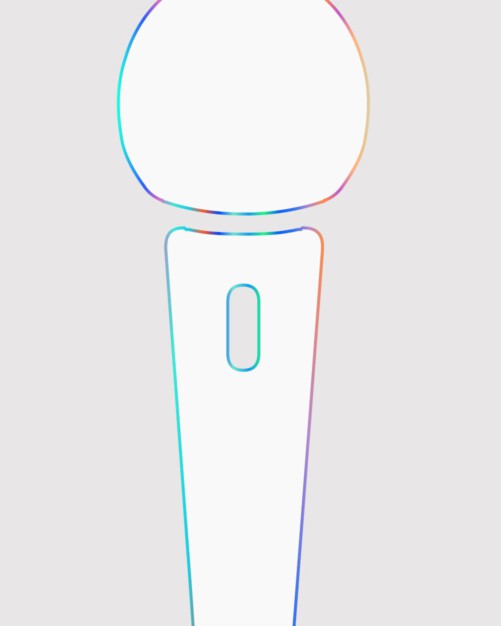
JugendTanzCompany Die JugendTanzCompany der fabrik Potsdam richtet sich an junge Tanzinteressierte, die neugierig sind und Lust haben, tiefer in den zeitgenössischen Tanz einzutauchen und selbst auf der Bühne zu stehen. Im wöchentlichen gemeinsamen Training lernen die Mitglieder der Company verschiedene Ansätze, Formen und Techniken des zeitgenössischen Tanzes, der Improvisation und der Choreografie kennen. Sie proben eigene Sequenzen und entwickeln gemeinsam Stücke für die Bühne.
Bei diesem kreativen und interaktiven Forumformat öffnen Wir einen Diskursraum, bei dem es auch laut werden kann: Welche neuen Leitbilder wollen Wir gestalten? Und wie? Du bist eingeladen von den Ansätzen aus Deiner eigenen Arbeit zu berichten. Wie kann Deine Idee zu einer Kulturvision der Zukunft beitragen? Welche
»Werkzeuge« und Praktiken benötigst Du hierfür? Entdecke, wie beispielsweise neue milieu- und klassenübergreifende Bündnisse in Kunst- und Kultur(-politik(en)) zu ungeahnten und innovativen Kulturkonzepten und Zukunftsentwürfen führen können.
Welche Rolle können hierbei junge Menschen spielen? Oder Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir begleiten Deine »Messungen« des
Miteinanders und formen gemeinsam den Entwurf eines visionären Kulturkonzeptes. Diesen präsentieren Wir anschließend im Plenum in einer Sprechperformance.

iwaipidindei_x_fiyyasco ist ein Designerkollektiv, das aus den Mannheimer Künstlergeschwistern Emre Yazar und Yasin Yazar besteht. Aufgewachsen in gleichen und doch unterschiedlichen Milieus, nutzen sie bei ihren Design- und Kunstprojekten spielerisch die Erfahrungswerte aus der unmittelbaren Interaktion, um
außergewöhnliche Interventionsprojekte für die Straße zu entwickeln. Diese sind auch dem Bereich Aktionskunst und Soziale Plastik zuzuordnen.
In der heutigen kulturpolitischen Landschaft stehen wir vor einer wachsenden Herausforderung: der Erosion des Dialogs. Dieser Trend manifestiert sich in verschiedenen Aspekten und Ereignissen, die exemplarisch für die alarmierende Entwicklung stehen, in der
ein bedeutender gesellschaftspolitischer Diskurs von einseitigen Monologen geprägt ist und ein inklusiver Dialog blockiert wird. Anstelle eines offenen Austauschs scheinen ‚Für mich‘ oder ‚Gegen mich‘-Narrative zu dominieren, die die Suche nach Kompromissen und das aktive Zuhören beeinträchtigen.
In einem interaktiven Forum gehen wir gemeinsam auf Entdeckungsreise, um kreative Lösungsansätze für die Überwindung von Polarisierung zu finden. Wir analysieren aktuelle Leitbilder und reflektieren die Herausforderungen in der Debattenkultur. Dabei lassen wir uns von den Visionen der Teilnehmenden inspirieren, um konkrete Aktionspläne zu entwerfen, die als Blaupausen für zukünftige Schritte dienen.

Miraklejo Wir sind ein interdisziplinäres Kollektiv, das sich auf kulturelle Transformationsprozesse spezialisiert hat. Unsere Vision ist es, eine überregionale Gemeinschaft zu schaffen, die innovative Ideen unterstützt und durch kulturelle Praxis die Demokratie belebt. Hierfür entwickeln wir gemeinsam mit kulturellen Akteuren und Organisationen nachhaltige Geschäfts- und Betriebsmodelle und setzen dabei auf eine gemeinwohlorientierte Grundhaltung, Vielfalt und progressiven Wissensaustausch.
Initiator*innen sind Ima Johnen, Musikwissenschaftlerin und CSR-Managerin, sowie Candy Glas-Würzburg, Kultur- und Eventmanager. Ima leitete die Riverside Studios und ist als systemische Organisationsentwicklerin & Transformationsdesignerin tätig. Candy bringt über 10 Jahre Erfahrung im Kultur- und Eventmanagement in Venues & auf Festivals mit und hat interdisziplinäre B2B-Formate mit Fokus auf Netzwerke und Kultur- und Stadtentwicklung für Organisationen konzipiert und realisiert.
Ziel des letzten Panels ist es, mit verschiedenen Akteuren darüber zu diskutieren, welche Strategien zur Überwindung von Polarisierung sie konkret (weiter)verfolgen werden – auch im Kontext der erarbeiteten Leitbilder für zukünftige KulturpolitikEN. Was wird jeweils ihr konkreter Beitrag zur Umsetzung sein? Dazu werden fünf Stehtische positioniert, an denen sich jeweils verschiedene Akteure aus den Arbeitsbereichen Kulturpolitik, kulturelle Bildung, Kommunen und Hochschulen versammeln und miteinander ins Gespräch kommen.



